Viele Unternehmen kennen es: das Problem, gute Mitarbeiter zu finden, die motiviert arbeiten, treu sind, gesund bleiben, sich selbst regulieren und organisieren können, Innovationen schaffen und für andere Mitarbeiter ein Gewinn sind.
Und viele Mitarbeiter kennen es: das Problem, ein Unternehmen zu finden, das sie ernst nimmt, weiterentwickelt, allenfalls maßvoll überfordert, in dem Selbstwirksamkeit die Regel ist und in dem mit netten Menschen schöne, sinnvolle Dinge hergestellt werden.
Hochkonjunktur haben Employer Branding-Agenturen, die Arbeitgebermarke und „Employee Experience“ mit „Purpose, Vision, Mission“ oder dem reißbretthaften „Storytelling“ „optimieren“ sollen. Der Aufbau einer „Corporate Identity“ über die Marke hinaus als Instrument (!) der Mitarbeiterbindung steht hoch im Kurs.
Aber nicht selten wirkt dies wie die technokratische Intervention in einen Tierpark. Dies erkennen beinahe alle, besonders die so Manipulierten. Die Folge ist die schlimmste Form lebendigen Totseins, nämlich der Zynismus, und mit ihm kommt es zu: Gereiztheit, Ärger, Ausbrennen.
Längst sind Unternehmen darauf geworfen, Identitätsbildung weniger als Agenturleistung zu verstehen, sondern mehr als ernsthaften, selbsttätigen Prozess – der beharrlich betrieben werden muss, der nicht in erster Linie viel Geld erfordert, sondern vor allem inneres Engagement der Unternehmenslenker.
Das alles hat Methode, denn nachdem in der spätmodernen Gesellschaft so ziemlich alle Institutionen geschreddert sind, reduzieren sich die Sinnangebote entsprechend. Und nicht zufällig scheitern Unternehmen bei der Vermittlung von Werten und Identitätsangeboten durch die allzu verführerische Fixierung auf bunte Bilder – neuerdings sogar KI-generiert, was besonders taktlose und billige Manipulationsversuche darstellen.
Der Philosoph Byung-Chul Han hat kürzlich den jüngsten Versuch seiner sozialphilosophischen Profession unternommen, uns das ganze Panorama des Problems vor Augen zu führen („Die Krise der Narration“, 2024, Suhrkamp). Seine Thesen für die spätmoderne Gesellschaft sind die folgenden:
Narrative Identitätsbildung schwindet: Früher halfen Geschichten dabei, das Leben zu strukturieren und Sinn zu stiften. Heute, so Han, wird das Ich zunehmend als ein Projekt ohne Richtung verstanden, das sich ständig neu erfinden muss.
Digitalisierung und Fragmentierung: Soziale Medien und digitale Kommunikation fördern keine zusammenhängenden Geschichten, sondern produzieren eine „Infobesity“ – eine Überfülle von Informationen, die keine Narration mehr zulassen.
Zeit und Beschleunigung: Die zunehmende Beschleunigung des Lebens und die Gegenwartsfixierung lassen wenig Raum für kontemplative Rückblicke oder Ausblicke – ebenfalls notwendig für erzählerische Strukturen.
Verlust des Zuhörens: In einer Welt, in der jeder „senden“ will, fehlt das Zuhören – ein essenzieller Teil jeder Narration. Ohne Zuhörer kann keine Erzählung lebendig werden.
Heilende Funktion von Narration: Han sieht in der Narration ein Heilmittel gegen Sinnlosigkeit, Fragmentierung und psychische Erschöpfung. Ihre Krise ist daher auch eine Krise des Menschseins.
Vielleicht sollte die Unternehmenskommunikation mehr Philosophie wagen? Was nämlich lernen wir daraus?
Statt Purpose, Vision und Mission – ein Dreiklang, der ebenso einfach wie unzulänglich ist – braucht es jemanden, der sich gern einmal wieder ans Erzählen macht. Wieso eigentlich erzählen Unternehmen so selten und herzlos ihre eigene Geschichte, und zwar durchaus auch die daran schwierigen Stränge: wie sie scheiterten, sich aufrieben, Gefahren umschifften, ratlos waren, Widerstände überwanden?
Statt Absender und Inhalte braucht es auch Zuhörer. Das geht schon damit los, dass Kommunikatoren „datengetrieben“ agieren. Die reinen Informationen sind nichts, ihre Platzierung in der Geschichte sind alles. Datengetrieben ist nichts anderes als eine Chiffre für erzählloses, damit auch geistloses, kopfloses Herumhantieren. Wie wäre es, statt dessen, mit erzählgetriebenem denken? Das entspräche unserem Hirn ohnehin viel besser, denn es ist schließlich nicht vor Computerbildschirmen, sondern in den Höhlen des Pleistozäns entstanden. Statt Stakeholder „zu vermessen“, besser die Aufforderung: „Komm, erzähl mal!“
Statt Storytelling, der am meisten gehypten Kommunikatorenmethode des aktuellen Jahrhunderts, das immer – wie Han schreibt – „Storyselling“ ist, und das darum immer mehr auch vom geringstmöglich kommunikationsaffinen Menschen als Manipulationsversuch erkannt wird, braucht es „Zonen freien miteinander Erzählens“. Statt Projektarbeit braucht es Erzählgeflechte.
Statt Schnipsel an Informationen, statt 99-cent-cervelatwurstigem Content und hemdsärmelig gezimmerten Narrativen am Reißbrett braucht es die Geschichte eines Unternehmens – und damit auch das Geschichte des Unternehmens: die mehrschichtigen Bedeutungen, die Offenheit und Reibung, die wirkliche – Achtung Modewort! – Ambiguität, aber auch den darin liegenden Zauber. Das Erzählen nicht als beherrschtes Instrument der Kommunikation, sondern als Verständigung mit heilsam unabsehbaren, unscharfen, unverfügbaren Ausgängen und Deutungen.
Statt irgendwelchem Gerede über die höheren Werte eines Unternehmens braucht es auch Ehrlichkeit zur Gewinnerzielungsabsicht, und dann wenigstens das Bekenntnis nicht nur zur Arbeit, sondern auch zur Ruhe, zur Kontemplation, zum Schauen, zur Einkehr. Denn sind wir mal ehrlich: Purpose kann ein Mensch aus 99 Prozent der Unternehmen unserer Gesellschaft nicht beziehen. Dagegen freilich liegt das Beglückende mehr und mehr nicht im Was, sondern im Wie.
Statt Unternehmenskommunikation im „Always-on“-Modus braucht die Krise der Aufmerksamkeit Tiefgang, Ruhe und Klarheit. Mehr noch als je zuvor wird gerade im KI-Zeitalter, in dem jeder Schwachsinn auf Knopfdruck „generiert“ und „crossmedial verbreitet“ werden kann, die Fähigkeit entscheidend, Nein zu sagen und Denkräume zu lassen. Keine technische Revolution der letzten 500 Jahre hat es vermocht, die Effizienzgewinne ins Wachstum der Zwischenräume, der Klugheit und der kräftigenden Ruhe zu überführen – und gerade heute hat die Beschleunigung oft einen so offenkundigen „rasenden Stillstand“ (Paul Virilio) erreicht, dass sie die mit ihr verfolgten Zwecke untergräbt und somit absurd wird.
Und warum ist das so? Weil für jene tiefe Gestaltung der wichtigsten Gestaltungskraft eines Unternehmens, nämlich Sinn und Werte, kaum Aufwand betrieben wird, zunehmend – trotz allem Unbehagen mit der eigenen Lebensführung und Zufriedenheit – eine wirklich ernsthafte, zu den Grundlagen dringende Beschäftigung mit dem Unternehmen verlernt wurde (was freilich für die Unternehmer, gerade in Deutschland, historisch ein Novum ist), und selbstverständlich: weil es Geld kostet, Energie kostet, weil es Reibung verursacht, weil es Zeit zum Nachdenken, zum Schauen, zum Irritiertsein, Aufmerken, Umwegen braucht.
Das ist alles richtig. Nur ist es leider so, dass die Wirksamkeit jedes Identitätsbildungsversuchs seit Alters her an die nicht beschleunigbaren Abläufe des Erzählens und Zuhörens gebunden sind – und Unternehmen, Organisationen, Gesellschaften werden scheitern, wenn sie sich nicht aufmachen, den Menschen als den „animal narrans“ wiederzuentdecken, also das geschichtenerzählende Wesen, welches sich in der Geschichte ungeplant, nicht beherrschbar, nicht vorhersehbar selbst erkundet, ja schafft. – Das ist die unerbittliche, nicht nur von Han vorgetragene, Einsicht einer Vielzahl sozialphilosophischer Gegenwartsdiagnosen.

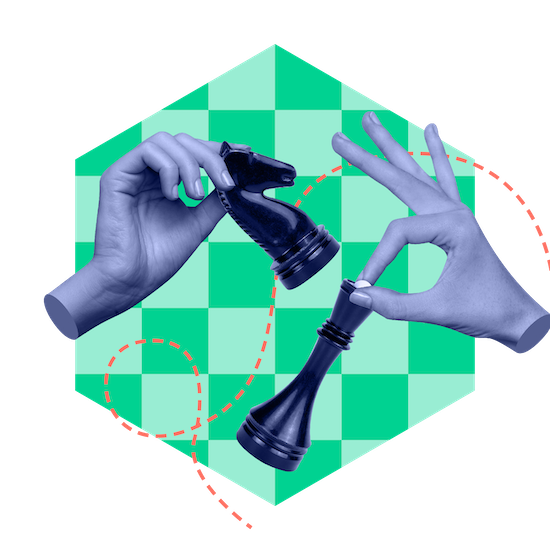
Schreibe einen Kommentar