Starbucks wird aktuell wegen schwerer Vorwürfe verklagt: Zwangsarbeit, Menschenhandel und miserable Arbeitsbedingungen bei Zulieferern. Der Fall zeigt: Auch ohne gesetzliche Verpflichtungen wie das deutsche Lieferkettengesetz sind Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte in globalen Lieferketten ein großes Reputationsrisiko – und weit mehr als ein PR-Problem.
In einer zunehmend sensibilisierten Öffentlichkeit wirkt moralisches Fehlverhalten nicht nur imageschädigend. Es bedroht direkt Umsatz, Gewinn und Unternehmenswert. Kunden, Investoren und Partner erwarten von Marken glaubwürdige Verantwortung – nicht nur Hochglanzberichte und Versprechen.
Werden diese Erwartungen enttäuscht, folgt der Vertrauensverlust schnell. Und Vertrauen ist eine der wichtigsten Währungen moderner Märkte.
Starbucks steht dabei exemplarisch für ein Risiko, das viele Unternehmen unterschätzen: Wer bei der Kontrolle seiner Lieferkette versagt oder ethische Standards nur auf dem Papier lebt, setzt langfristig sein Geschäftsmodell aufs Spiel. Gerade große Marken, die von positiven Emotionen und Loyalität leben, sind verletzlich. Sie müssen zeigen, dass sie Ethik nicht auslagern, sondern aktiv in ihr unternehmerisches Handeln integrieren.
Der Fall Starbucks erinnert uns daran: Lieferketten-Compliance ist keine lästige Pflicht – sie ist eine Frage unternehmerischer Weitsicht. Ähnliches gilt für die Analyse der Wesentlichkeit von ESG-Themen, die letztlich nichts anderes sind als moralische Erwartungen von Stakeholdern.
Die Politik – mit Lieferkettengesetz oder CSRD – ist am Ende eben doch nur die Nachhut der Gesellschaft, nicht deren Taktgeber. Darum verschwinden die Probleme nicht schon deshalb, weil Regulierung im Zuge der Volten in Berlin oder Brüssel entschärft, verschoben oder (zeitweise) abgeschafft wird.

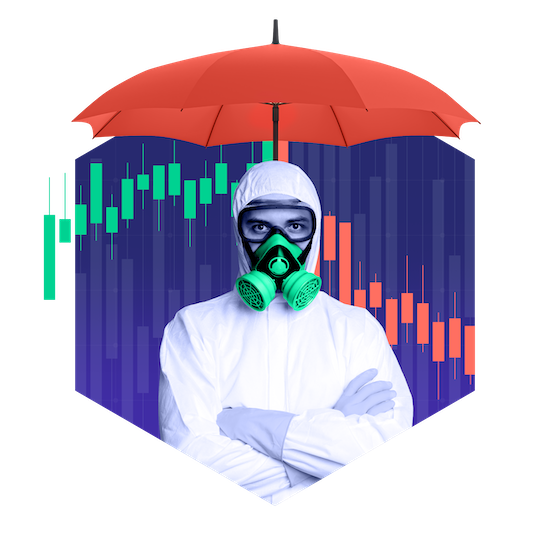
Schreibe einen Kommentar