Die Einführung von KI in der Unternehmenskommunikation weckt die Besorgnis, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert würden. Das ist ein typischer Reflex – ein Reflex, den es bereits seit der Erfindung der Dampfmaschine gibt. In den 1990er Jahren wurde das prominent unter dem Schlagwort „Wegrationalisierung“ diskutiert – was bei damals vier Millionen Arbeitslosen die Stimmung bei Vielen verdüsterte.
Rebound-Effekte
Führt die höhere Effizienz durch KI dazu, dass Unternehmen Ressourcen sparen? Die Beobachtung vieler Innovationen zeigt: Nein. Effizienz führt in den meisten Fällen zur Steigerung des Outputs. Effizienzgewinne sind geradezu Treiber von Outputsteigerungen, weil die Stückkosten sinken und die produzierten Güter bzw. Services günstiger hergestellt werden und folglich stärker nachgefragt werden.
Das sind die sogenannten Rebound-Effekte: Das gilt für Stahl seit dem 19. Jahrhundert, für Automobile oder den Flugbetrieb im 20. und 21. Jahrhundert – und das wird auch für die Unternehmenskommunikation und den KI-Einsatz gelten.
Mehr Effizienz trifft auf große Nachfrage nach mehr Effektivität
Warum? Weil für die Ressourcen, die KI-Effizienzgewinne freisetzen, eine hohe Nachfrage im Kommunikationssektor besteht – nämlich um die Effektivität zu steigern. Schließlich wächst die Nachfrage nach Inhalten, Reichweite und Exzellenz:
- Mehr Inhalte: Unternehmen und Organisationen erhöhen die Frequenz und Diversität ihrer Inhalte. Die Menge an Online zugänglichen Inhalten wächst exponentiell.
- Mehr Stakeholder: Durch KI-gestützte Analysen lassen sich Zielgruppen granularer ansprechen. Wo früher allgemeine Kommunikationsstrategien ausreichten, werden heute – fast schon hyper-personalisierte – Inhalte für ein immer größer werdendes Set an Zielgruppen erstellt.
- Mehr Kanäle: Digitale Kommunikation fragmentiert sich weiter – und das sogar mit zunehmender Geschwindigkeit. Unternehmen bespielen heute neben klassischen Medien und Social Media auch Plattformen wie WhatsApp Channels, Podcasts und spezialisierte Foren. Hinzu kommt eine wachsende Pluralität an Fachmedien (Print, Online, „Rundfunk“) oder Formaten für Veranstaltungen (sowohl intern wie extern). KI ermöglicht eine (teilweise) Automatisierung dieser Vielkanal-Strategien – und macht sie damit erst so richtig attraktiv.
- Höhere Exzellenz-Anforderungen: Die Qualitätsschwelle für exzellente Inhalte steigt. KI generiert bereits massenhaft solide Inhalte – Menschen müssen kreativer, tiefgründiger und origineller sein, um sich abzuheben. Nebenbei bemerkt: Das ist in den meisten Fällen nicht einmal eine echte Herausforderung. Wer sich mit dem zufriedengibt, was ChatGPT auf ein leeres Blatt zaubert, verkauft billigen Content an dumme Konsumenten. Auch dafür gibt es Nachfrage, freilich! Aber das verändert die Aufgaben von Kommunikatoren nicht ums Ganze.
Das Paradoxon der KI-Produktivität
Logisch: Selbst wenn KI die Effizienz um 50 % steigert, wird dieser Effekt komplett absorbiert, sobald sich Inhalte, Stakeholder und Kanäle verdoppelt haben. In den meisten Fällen ist das ein ganz und gar betriebswirtschaftlich zweckmäßiger Vorgang, weil Unternehmen bestrebt sind, die durch Automatisierung gewonnenen Kapazitäten im Wettbewerb zu nutzen, anstatt sie einzusparen. Anders gewendet: Wer an der Kommunikation die KI-Effizienzgewinne einspart, statt sie für die vielfältigen Möglichkeiten für mehr Effektivität zu nutzen, wird im Wettbewerb Nachteile haben.
„Sich neu erfinden“ ist Business as Usual
Ein Problem haben also nicht Kommunikatoren per se – sondern nur jene, die vorwiegend Aufgaben erledigen, die eine KI übernehmen kann und sich nicht anders oder nicht in Verbindung mit KI neu spezialisieren. Doch genau das ist Business as Usual: Das galt schon für die Erfindung des Buchdrucks, des Fernsehens, des Internets – und gilt nun ebenso für den breitenwirksamen Einsatz von KI in der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft.
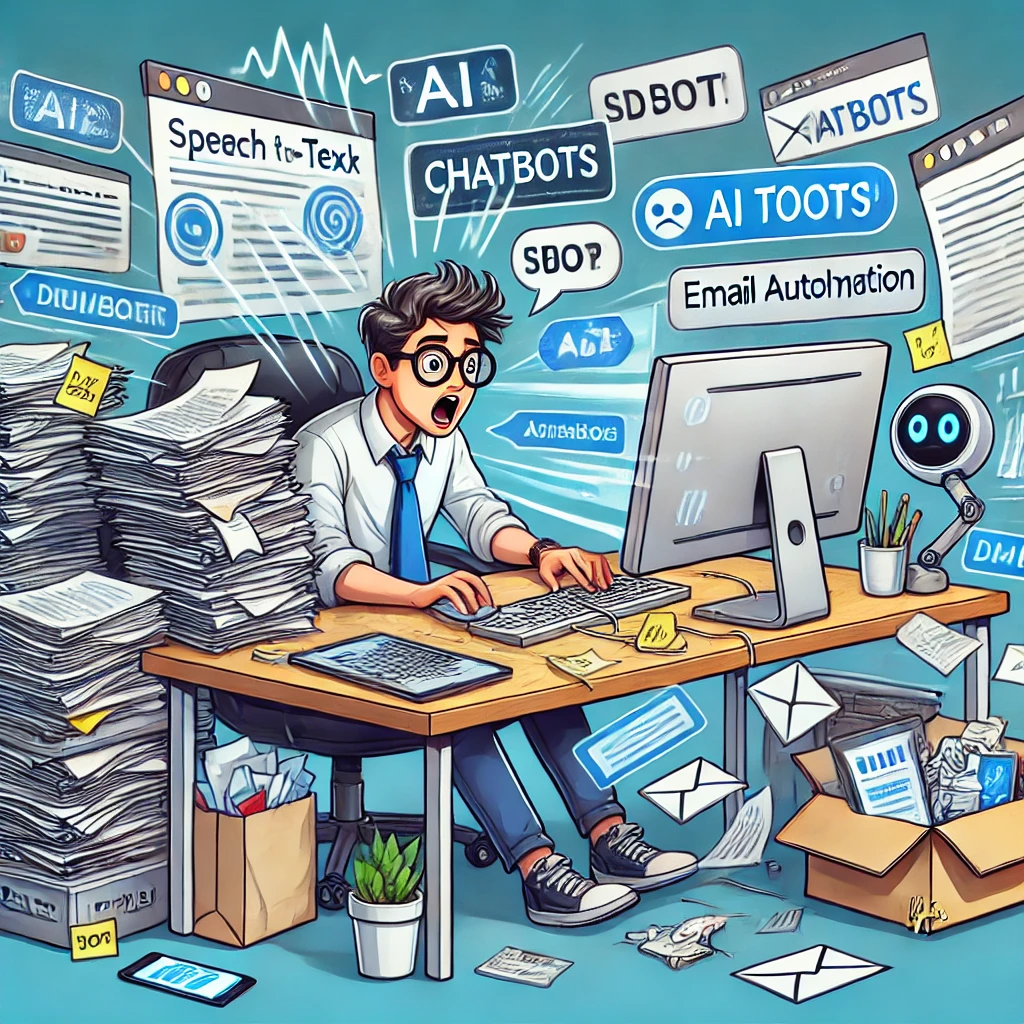

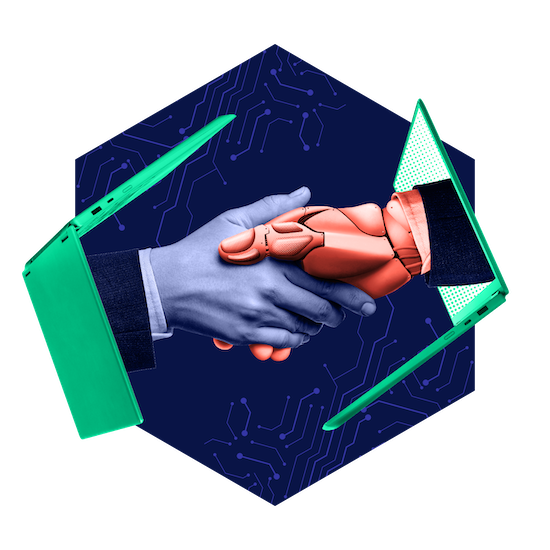
Schreibe einen Kommentar