In einer zunehmend politisierten Gesellschaft sehen sich Unternehmen häufiger gefordert, politische Statements abzugeben. Grob skizziert, geschieht dies aus zwei Gründen:
- Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung: Unternehmen in Deutschland sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGO) verpflichtet. Diese Basis unserer Gesellschaft zu wahren, ist nicht nur im Interesse der Wirtschaft, sondern entspricht – gottlob – auch ihren Werten.
- Wirtschaftspolitische Interessen: Unternehmen verfolgen spezifische wirtschaftspolitische Ziele, die durch politische Äußerungen gefördert werden können. Schlagworte wie Corporate Activism, CEO Activism oder Corporate Political Communication stehen exemplarisch für diese Entwicklung.
Pluralismus und Reputationsdilemma
Politische Äußerungen bergen jedoch erhebliche Risiken. Demokratie fußt auf Pluralismus, also der legitimen Vielfalt an Meinungen und Interessen, auf den Wettbewerb dieser Meinungen und Interessen im öffentlichen Wettstreit.
Für Unternehmen führt dies jedoch notwendigerweise zu einem Reputationsdilemma: Was bei einer Zielgruppe Zustimmung findet, kann bei einer anderen Ablehnung hervorrufen. Politische Statements können also Anerkennung bei einer Stakeholdergruppe gewinnen, während sie gleichzeitig Reputationsverluste bei anderen nach sich ziehen.
Dies stellt Kommunikatoren vor die Herausforderung, strategisch mit diesem Spannungsfeld umzugehen.

Das gilt insbesondere, da dieses Dilemma umso größer wird, da die Bundesrepublik Deutschland (und mit ihr viele andere westliche Staaten) eine stärkere politische Polarisierung haben als je zuvor – und zwar nachweislich stärker als in den politisch spannungsreichen 70er oder 80er Jahren. Folglich sind viele Themen äußerst umstritten, Konsens ist Mangelware, und Unternehmen haben es darum besonders schwer, das Reputationsdilemma zu vermeiden, wenn sie sich politische äußern oder engagieren.
Für viele Unternehmen ist das bei den eigenen Mitarbeitern und Kunden ein sehr greifbares Problem, denn diese wichtigen Stakeholdergruppen sind politisch bei vielen Unternehmen ähnlich divers wie der Querschnitt der Gesellschaft.
Wie Unternehmen mit politischer Kommunikation umgehen sollten
Aus meiner Sicht als politischer Beobachter wie strategischer Kommunikationsberater ergeben sich einige klare Regeln für politische Äußerungen durch Unternehmen.
- ‚Audience Management‘ allein reicht nicht aus: Die Vernetzung von Stakeholdern erschwert es, politische Botschaften nur in ausgewählten Kreisen zu kommunizieren. Aussagen, die in einer Arena geäußert werden, gelangen beinahe unweigerlich in andere Kreise. Schon von daher ist es wenig ratsam, mit „gespaltener Zunge“ zu sprechen – einmal abgesehen davon, dass widersprüchliche Botschaften ein ethisches Problem darstellen.
- Die fdGO verstehen und verteidigen: Die fdGO ist klar durch das Bundesverfassungsgericht definiert. Viele Meinungen, die kontrovers erscheinen, sind durch die Demokratie geschützt – auch solche, die als falsch oder absurd wahrgenommen werden. Unternehmen sollten diese Meinungsfreiheit anerkennen, anstatt Positionen vorschnell als extremistisch zu etikettieren. Stattdessen müssen sich Unternehmen inhaltlich mit diesen auseinandersetzen. Beispiele für dergleichen kontroverse Themen sind: Deutschlands Rolle in der NATO, die Migrationspolitik, Geschlechtergerechtigkeit, Energiepolitik und so weiter.
- Eigene Interessen mit Bedacht vertreten: Es ist legitim, eigene wirtschaftspolitische Interessen zu verfolgen, aber ebenso legitim, dass andere Akteure gegenteilige Positionen einnehmen. Themen wie Marktsteuerung, Handelspolitik oder Energiepreise bieten Konfliktpotenzial und müssen sensibel kommuniziert werden.
- Risikomanagement etablieren: Ein solides Issues Management ist unverzichtbar. Es analysiert, welche Stakeholder welche Ansichten vertreten, und ermöglicht eine strategische Vorbereitung. Politische Botschaften sollten nach ihrem Ertragswert priorisiert und gegebenenfalls angepasst werden. Mögliche Kontroversen sollten umfassend vorgedacht werden – ähnlich wie in der Krisenkommunikation.
Zwei Extreme vermeiden
Häufig begegnen wir zwei problematischen Ansätzen:
- Blauäugigkeit: Unternehmen äußern sich ohne Vorbereitung und werden von „Shitstorms“ überrascht, erleiden erhebliche Reputationsschäden.
- Leere Floskeln: Politische Statements sind so allgemein und austauschbar, dass sie jede Glaubwürdigkeit verlieren.
Es kann also durchaus richtig sein, sich nicht zu äußern – um den Stakeholderfrieden zu wahren. Dieser ist immerhin ein hohes Gut. Doch Unternehmen, die sich äußern, sollten sich als Corporate Citizen verstehen und bereit sein, Angriffe argumentativ zu begegnen.
Grenzen der Meinungsfreiheit respektieren
Gleichwohl: Unternehmen müssen die fdGO und ihre Prinzipien kennen. Es gilt, Meinungsfreiheit zu verteidigen, gleichzeitig die Feinde der Demokratie zu erkennen. Die Devise muss lauten: Keine Freiheit den Feinden der Freiheit! Unternehmen sollten klar extremistische Positionen verurteilen, ohne die Legitimität kontroverser Meinungsäußerungen infrage zu stellen.
Fazit
Politische Äußerungen erfordern konzeptionelle Klarheit bei den Absendern, durchaus auch Mut und insbesondere Verantwortungsbewusstsein. Unternehmen, die sich der Herausforderung stellen, können langfristig ihre Rolle als glaubwürdige gesellschaftliche Akteure stärken.
Dies setzt voraus, dass sie die Prinzipien der Demokratie und die Logik von Extremismus verstehen, kontroverse Themen reflektieren und eine klaren Plan haben. Hier gibt es meiner Erfahrung nach Nachholbedarf. Denn nur so lassen sich die Chancen politischer Äußerungen nutzen, ohne unnötige Reputationsrisiken einzugehen.
Weitere Gedanken u.a. auch hierzu finden sich in: Fritzsche, Erik / Reinsberg, Constanze / Weichert, Robert, 2024, Workbook Sustainability: ESG-Faktoren verstehen, den Wandel meistern, die CSRD umsetzen, Bundesanzeiger-Verlag, 172 Seiten.

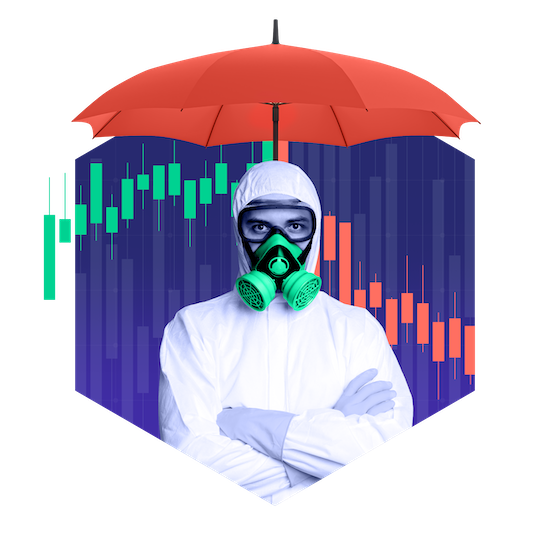
Schreibe einen Kommentar